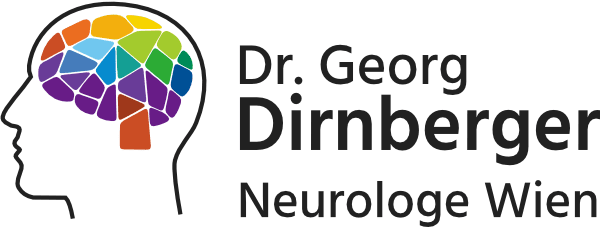Typische Symptome der Muskelerkrankungen sind Muskelschwäche, rasche Ermüdbarkeit und Verschmächtigung der Muskulatur. Oft wird vereinfachend von Muskelschwund gesprochen. Bei manchen Erkrankungen treten dazu Muskelschmerzen oder Krämpfe auf.
Man unterscheidet zwischen Muskelerkrankungen im engeren Sinne, Erkrankungen des neuromuskulären Überganges (im winzigen Zwischenraum zwischen Nervenendigung und Muskel) und Erkrankungen der die Muskulatur versorgenden Nerven die – da der Muskel die Nervenerkrankung „bemerkt“ und darauf reagiert – auch zu krankhaften Veränderungen an den betroffenen Muskeln führen.
Muskelerkrankungen im engeren Sinne
Dies sind Erkrankungen der Muskelzellen, insbesondere der sogenannten quergestreiften Muskulatur mit der wir Arme und Beine bewegen, das Zwerchfell beim Atmen, und unsere Gesichtsmuskulatur, wenn wir lachen oder weinen. Muskelerkrankungen im engeren Sinn sind die Muskeldystrophie, Muskelentzündung und Stoffwechselerkrankung des Muskels.
Muskeldystrophien
Muskeldystrophien sind zuallererst durch Schwächen gekennzeichnet, die meist besonders die rumpfnahe Muskulatur (Oberschenkel, Oberarme) betrifft. Welche Muskelgruppen vordringlich betroffen sind und wie der Verlauf ist, hängt von der speziellen Erkrankung ab. Die häufigsten, X-cromosomal rezessiv vererbten Formen der Muskeldystrophie sind:
- Muskeldystrophie Typ Duchenne (maligner Beckengürteltyp)
- Muskeldystrophie Typ Becker-Kiener (benigner Beckengürteltyp)
- Muskeldystrophie Typ Emery-Dreifuss (humeroperonealer Typ)
Bei den Muskeldystrophien vom Typ Becker-Kiener und Typ Duchenne sind zunächst die Hüftmuskulatur betroffen, bei der Muskeldystrophie vom Typ Emery-Dreifuss besonders Schultern, Oberarmen und Waden.
Beispiele für weitere, seltenere Formen der Muskeldystrophien sind:
- kongenitale Muskeldystrophie
- Gliedergürteldystrophie
- facioskapulohumerale Muskeldystrophie
Bei allen Formen der Muskeldystrophien wird die betroffene Muskulatur schmächtiger. Allerdings können bestimmte Muskelgruppen äußerlich sehr kräftig und gut ausgebildet erscheinen, da die Muskulatur teilweise durch Binde- und Fettgewebe ersetzt ist das „dicker“ erscheint als die zuvor vorhandene Muskulatur. Besonders häufig ist dies an den Waden zu beobachten – man spricht von sogenannter Pseudohypertrophie.
Zu beachten ist die bei einigen Muskeldystrophien auftretende Beteiligung der Herzmuskulatur.
Muskelentzündungen
Die Muskelentzündungen stellen eine uneinheitliche Gruppe von Muskelerkrankungen dar. Es gibt durch Erreger (Bakterien, Viren) bedingte Muskelentzündungen und solche bei denen die Körperabwehr, das Immunsystem, aus einem Irrtum heraus eigenes Gewebe, hier bestimmte Muskelzellen, angreift.
Die Unterscheidung zwischen erregerbedingter Muskelentzündung und Autoimmunerkrankung ist wichtig, da im ersten Fall das Immunsystem gestärkt werden muss um einen feindlichen Erreger zu bekämpfen, im zweiten Fall aber gebremst werden muss da ein Angriff auf gesundes Muskelgewebe zu Unrecht erfolgt.
Sowohl erregerbedingte Muskelentzündung als auch Autoimmunerkrankung lassen sich meist gut medikamentös behandeln.
Stoffwechselerkrankung des Muskels
Bei Stoffwechselerkrankung des Muskels werden zwar wie im gesunden Muskel Kohlenhydrate und Fette in die Muskelfaser aufgenommen, können aber nicht abgebaut (nicht metabolisiert) und dabei zur Energiegewinnung genutzt werden. Dieser Energiemangel macht sich als Schwäche bemerkbar. Je nach Erkrankungen liegt das Maximum der Schwäche bei unterschiedlichen Muskelgruppen. Mitunter kann es auch zu belastungsabhängigen Muskelschmerzen kommen. Beispiele für Stoffwechselerkrankung des Muskels sind Glykogenosen und Lipidspeichermyopathien.
Erkrankungen des neuromuskulären Überganges
Die beiden mit Abstand häufigsten Erkrankungen des neuromuskulären Überganges sind die Myasthenia gravis und das Lambert-Eaton-Syndrom.
Beide Erkrankungen sind sogenannte Autoimmunkrankheiten. Das bedeutet, dass der Körpers aus einem Irrtum heraus eigenes Gewebe angreift. Bei Myasthenie und Lambert-Eaton-Syndrom richtet sich dieser Angriff gegen Eiweißverbindungen (Rezeptoren) am Übergangs vom Nerv zum Muskel, Teile der sogenannten motorischen Endplatte.
Myasthenia gravis
Bei der Myasthenia gravis lässt typischerweise die Kraft der betroffenen Muskel bei Belastung rasch nach. Nach einer Ruhepause kann die Muskulatur dann wieder eingesetzt werden. Besonders stark ist häufig die Muskulatur zur Bewegung der Augen und zum Heben der Augenlider betroffen, aber auch auf die rumpfnahe Muskulatur. Bei schweren Verläufen kann auch die Atemmuskulatur betroffen sein. Meist lässt sich die Erkrankung mit Medikamenten gut lindern.
Lambert-Eaton-Syndrom
Beim selteneren Lambert-Eaton-Syndroms stehen Schwäche und Ermüdbarkeit der rumpfnahen Muskulatur im Vordergrund, insbesondere der Becken- und Oberschenkelmuskulatur, doch auch hier kommen Schwächen der Augen-, Sprech- und Schluckmuskulatur vor. Die Kraft ist bei der Prüfung eines betroffenen Muskels typischerweise zunächst gering, nimmt dann für kurze Zeit zu, bis schließlich (früher als bei Gesunden) erneut Erschöpfung eintritt. Bei etwa bei der Hälfte der Patienten tritt die Erkrankung gemeinsam mit einer Tumorerkrankung als sogenanntes paraneoplastisches Syndrom auf. Auch das Lambert-Eaton-Syndrom ist zumeist gut mit Medikamenten zu behandeln.
Erkrankungen der die Muskulatur versorgenden Nerven
Die spinale Muskelatrophie ist ein Beispiel für eine neuromuskuläre Erkrankung, bei der Muskelzellen und die sie versorgenden Nerven gemeinsam beeinträchtigt sind. Ursache der spinalen Muskelatrophie ist eine Erkrankung von Zellen im Rückenmark, deren Ausläufer als Nervenfasern bis zu den Muskeln an Rumpf, Armen und Beinen ziehen. Während die Ursache der Erkrankung also in den Nervenzellen liegt, „bemerken“ die Muskeln die fehlende Nervenversorgung und werden schwächer. So ist der Muskel das Organ, durch dessen Schwäche die Erkrankung erst auffällt.
Je nach Verlaufsform liegt die Schwäche bereits bei der Geburt vor und schreitet rasch fort (Typ Werding-Hoffmann) oder tritt erst im Erwachsenenalter auf und schreitet langsam voran (Typ Kugelberg-Welander).
Wann soll ich zum Neurologen gehen?
Wenn Sie Muskelzittern, unwillkürliche Zuckungen, Schwäche, Verschmächtigung der Muskulatur, Ungeschicklichkeit oder eine Gangstörung bemerken, die nicht durch ein jüngstes Bagatelle-Ereignis zu erklären sind, sollten Sie zum Neurologen gehen.
Sofern Sie befürchten an einer Muskelerkrankung zu leiden und dies abklären möchten, freue ich mich auf Ihren Besuch in meiner Ordination in 1010 Wien!
Nach einem umfassenden Gespräch (Anamnese) und einer eingehenden neurologischen Untersuchung würde ich in aller Regel eine Reihe von Zusatzuntersuchungen anfordern – welche Untersuchungen im Detail hängt von Ihrem Beschwerdebild ab. Sobald eine Diagnose gestellt werden kann, erkläre ich Ihnen diese ausführlich und kann Ihnen Optionen für die Behandlung vorschlagen.